|
|
|
|
|
 |
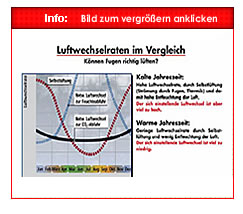 |
|
|
Der
Glaube, ein Gebäude müsse Ritzen und Fugen haben, um „natürlich zu atmen“,
ist falsch. Ein solcher Luftwechsel erfolgt unkontrolliert, es gelangt zu
viel oder zu wenig Frischluft ins Gebäudeinnere; Schadstoffe und Staub aus
der Dämmung mischen sich zudem in die Raumluft. Die Lüftung eines Gebäudes
sollte daher über das mehrmalige Öffnen der Fenster oder aber durch eine
Lüftungsanlage erfolgen. Öffnen der Fenster oder aber durch eine
Lüftungsanlage erfolgen. |
|
Luftwechselraten im Vergleich
Von einem luftdichten
Gebäude spricht man, wenn die Luft im Gebäude unter Prüfbedingungen nicht
häufiger als drei Mal pro Stunde ausgetauscht wird. Wird eine Lüftungsanlage
im Haus installiert, darf der Luftwechsel gem. Energieeinsparverordnung (EnEV
2002, Anhang 4 Nr. 2) bei Prüfdruck max. 1,5 m³ pro Stunde betragen.
„Luftdicht“ bedeutet dabei nicht das totale luftdichte
Verschließen, sondern meint die Vermeidung ungewollter Leckagen in der
Gebäudehülle. Denn: Warmluft strömt durch Fugen nach außen - das kostet
Energie.
Gleichzeitig transportiert die warme Luft Feuchtigkeit, die sich in der
Außenwand des Gebäudes abkühlt und kondensiert; das entstehende Tauwasser
kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen. Dringt Außenluft durch Fugen ins
Gebäudeinnere, werden zudem Allergene aus der Dämmung und Staubpartikel in
das Haus transportiert; gesundheitliche Beeinträchtigungen können die Folge
sein.
|
|
Typische Leckagen in Gebäuden
Konstruktionsbedingte Leckagen bzw. Undichtheiten treten oft
an Anschlüssen und Durchdringungen auf. Hier sollte die
Luftdichtheitsschicht insbesondere detailliert geplant werden, um spätere
kostenintensive Nachbesserungen zu vermeiden. |
|
Typische Leckagen treten überwiegend in folgenden Bereichen auf: |
|

|
bei Verbindungen und
Stößen von Bauteilen |
 |
bei Rohr- und
Kabeldurchführungen durch die Luftdichtheitsschicht |
 |
Anschlüsse zum Boden bei
Türen und bodentiefen Fenstern im ausgebauten Dachgeschoss |
 |
an Stoßstellen
verschiedener Baumaterialien (z. B. Massiv-/Leichtbau) |
 |
bei Anbauten und Erkern |
 |
an Fenster- und
Außentürleibungen |
 |
bei Dachflächenfenstern
und Gauben |
 |
bei Bodenluken |
|
Vorteile die bei Ausführung einer Blower- Door- Prüfung entstehen: |
 |
spürbare Senkung des
(Heiz-) Energieverbrauchs |
 |
Einforderung von
Rechtsansprüchen oder Nachweispflichten |
 |
Verbesserung im Schall-,
Wärme- und Brandschutz |
 |
Vermeidung von Bauschäden
durch Feuchtigkeit |
 |
Verbesserung des Wohnklima
( Behaglichkeit ) durch Vermeidung von Zugluft |
 |
Check für Wirksamkeit
einer kontrollierten Lüftung |
 |
Überprüfung der
Bauqualität oder der Abdichtung im Trockenbau |
|
|
|
Das Messverfahren:
Die Minneapolis Blower- Door wird in Deutschland seit
1989 zur Messung der Luftdichtheit eingesetzt und ist heute eines der
erfolgreichsten Luftdichtheitsmessgeräte weltweit. Die
Gebäudethermografie ergänzt die Prüfung der Gebäudehülle während der
Blower- Door-Messung optimal: Umfassende Aussagen zum Zustand der
Gebäudehülle können getroffen und im Rahmen der Qualitätssicherung
anschaulich dokumentiert werden.
Für die Messung wird ein Blower- Door-Ventilator in eine
Außentür oder in ein Fenster des Gebäudes eingesetzt.
Alle weiteren Außentüren und Fenster werden geschlossen,
alle Innentüren des Gebäudes bleiben geöffnet. Das automatisierte
Blower- Door- Messverfahren wird als anerkannte Regel der Technik nach
DIN EN 13829 durchgeführt. Dazu wird mit Hilfe des Blower-
Door-Ventilators kontinuierlich so viel Luft aus dem Gebäude gesogen,
dass ein nicht wahrnehmbarer Unterdruck von 50 Pascal im Gebäude erzeugt
wird. Sie können ohne Beeinträchtigung während der Messung im Gebäude
bleiben. Sind Leckagen in der Gebäudehülle vorhanden, strömt durch diese
Außenluft ins Gebäudeinnere. Während des Gebäuderundganges werden die im
Haus vorhandenen Luftströmungen per Luftgeschwindigkeitsmessgerät, mit
Rauch oder Infrarot- Thermografie lokalisiert.
Ich empfehle die Blower- Door- Messung zu einem Zeitpunkt, an dem die
luftdichte Hülle noch sichtbar ist, denn dann können Leckagen gezielt
und mit wenig Aufwand erkannt und beseitigt werden. Erfolgt die
Luftdichtheitsmessung erst im Nutzungszustand, sind Nachbesserungen
oftmals sehr aufwändig und kostenintensiv. |
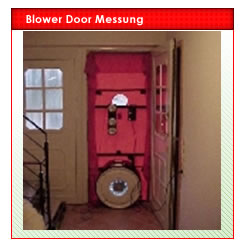 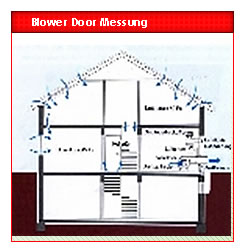
|
| |
|
 |
|
|